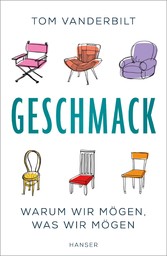Tom Vanderbilt
Geschmack
Warum wir mögen, was wir mögen
»Und ihr sagt mir, Freunde, daß nicht zu streiten sei
über Geschmack und Schmecken? Aber alles Leben ist
Streit um Geschmack und Schmecken!«
Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra
Einleitung
WAS IST IHRE LIEBLINGSFARBE
(UND WARUM HABEN SIE
ÜBERHAUPT EINE)?
»Was ist deine Lieblingsfarbe?«
Die Frage stellte mir meine fünfjährige Tochter eines Morgens auf dem Weg zur Schule. Sie hat neuerdings ihre »Lieblingssachen« entdeckt, erzählt mir von ihren und erkundigt sich nach meinen.
»Blau«, antworte ich und fühle mich wie das Aushängeschild für den westlichen Mann: Blau ist in der westlichen Welt beliebt, bei Männern noch mehr als bei Frauen.
Pause. »Und warum ist dein Auto dann nicht blau?«
»Tja, Blau gefällt mir, aber blaue Autos eben nicht so.«
Meine Tochter denkt ein Weilchen nach, dann: »Meine Lieblingsfarbe ist Rot.« Das war neu. Letzte Woche war es noch Rosa. Bald kommt wahrscheinlich sogar Grün ins Spiel.
»Trägst du darum heute eine rote Hose?«, frage ich.
Sie lächelt. »Hast du auch eine rote Hose?«
»Nein.« Als ich noch in Spanien lebte, kaufte ich mir eine rote Hose und trug sie auch, weil ich das bei den Spaniern so gesehen hatte. Aber als ich nach New York umzog, wo kaum ein Mann rote Hosen trug, blieb die Hose im Schrank. Was in Madrid damals verbreitet war, war in Amerika, zumindest in meinen Augen, 1991 noch Trendsettern vorbehalten. Aber all das behalte ich für mich.
»Am besten kaufst du dir eine rote Hose.«
»Meinst du?«
Sie nickt. »Was ist deine Lieblingszahl?«
Jetzt bin ich platt. »Hm. Ich weiß nicht, ob ich eine Lieblingszahl habe.« Dann sage ich: »Vielleicht acht.« Und versuche im selben Moment zu verstehen, warum »acht«? Weil ich diese Zahl als Kind am liebsten schrieb?
»Meine ist sechs«, sagt meine Tochter.
»Warum?«
Sie zuckt mit den Schultern und runzelt die Stirn. »Ich weiß nicht. ›Sechs‹ gefällt mir einfach.«
Warum gefällt uns, was uns gefällt? In unserer kurzen Unterhaltung haben meine Tochter und ich mindestens fünf Grundprinzipien gestreift, die in der Geschmacksforschung eine Rolle spielen. So beziehen sich unsere Vorlieben, erstens, normalerweise auf Kategorien: Blau gefällt mir, aber eben nicht am Auto. Vielleicht mögen Sie Orangensaft, aber nicht im Cocktail. Zweitens sind unsere Vorlieben meist kontextabhängig. In Spanien fand ich rote Hosen toll, in New York eher weniger. Wahrscheinlich haben Sie auch schon einmal heißgeliebte Souvenirs wie Espadrilles oder bunte Decken aus dem Urlaub mitgebracht, die nun zu Hause ein kümmerliches Dasein in der Abstellkammer fristen. In der Sommerhitze kaufen die Leute seltener schwarze Autos und sind bereit, mehr für ein Haus mit Swimmingpool zu zahlen.1 Drittens sind unsere Vorlieben häufig konstruiert. Als ich meine Lieblingszahl verraten sollte, tauchte vor meinen Augen eine Zahl auf – mit der Begründung gleich im Schlepptau. Viertens sind Vorlieben inhärent vergleichend. Noch ehe Kinder sprechen können, fühlen sie sich offenbar stärker zu denen hingezogen, die ihre Vorlieben teilen. So ließ eine klug angelegte – und für den Zuschauer zweifellos lustige Studie – Kleinkinder zunächst zwischen zwei Gerichten wählen. Dann zeigte man den Kindern Puppen, die eine offene »Vorliebe« oder »Abneigung« für das gewählte Gericht ausdrückten. Als man den Kindern die Puppen schließlich hinhielt, griffen sie tendenziell nach denen, die dasselbe Gericht »bevorzugten« wie sie.2 Fünftens sind unsere Vorlieben ärgerlicherweise selten angeboren:3 Wir versuchen, auf unsere Kinder einzuwirken, und geben ihnen jede Menge Erbgut mit, und doch haben sie selten dieselben Vorlieben wie wir.
Die Unterhaltung zwischen meiner Tochter und mir endete mit einer der bekanntesten Einsichten in puncto Geschmackssachen: Vorlieben und Abneigungen sind manchmal verdammt schwer zu begründen. So bedauerte der Philosoph Edmund Burke schon vor dreihundert Jahren in einer der ersten Abhandlungen über den Geschmack, »daß diese feine und geistige Fähigkeit, die zu volatilisch scheint, die Fesseln einer Definition zu vertragen, noch weit weniger auf einen gewissen Probierstein gebracht, und nach einem sichern Maßstabe ausgemessen werden« kann.4
Und wer sich dennoch abmühte, den Geschmack zu verstehen, vermeinte am Ende oft, da gebe es wohl nicht viel zu erklären. »Angenommene Geschmacksunterschiede konnten noch nie zur Erklärung eines signifikanten Verhaltens beitragen«, schreiben die Nobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler George Stigler und Gary Becker.5 Da jedes Verhalten, wie die Vorliebe meiner Tochter für die Zahl sechs, reine Geschmackssache sei, könne der Geschmack offensichtlich »alles und darum nichts« erklären.6 Wer über Geschmack streite, könne genauso gut über die Rocky Mountains streiten: »Beide existieren heute, genauso in einem Jahr und für alle Menschen gleichermaßen.«
Doch die Rocky Mountains verändern sich, wie andere Wirtschaftswissenschaftler eingewendet haben, wenn auch nicht in einer für uns wahrnehmbaren Geschwindigkeit.7 In zahllosen Studien wiesen Psychologen, häufig unterstützt durch Neurowissenschaftler, nach, dass sich der Geschmack verändert, oft sogar in ein- und demselben Versuch: Das Essen schmeckt uns besser, wenn wir dazu eine bestimmte Musik hören, oder ein Musikstück gefällt uns schlechter, wenn wir Negatives über den Komponisten hören.
Unser Geschmack scheint geradezu endlos »anpassungsfähig« – um es mit dem einflussreichen norwegischen Sozialwissenschaftler Jon Elster zu sagen. Elster zitiert die Fabel vom glücklosen Fuchs, der die begehrten, aber unerreichbaren Trauben kurzerhand für zu »sauer« erklärt. Der Fuchs begnüge sich nicht einfach mit der zweitbesten Wahl – wie vielleicht die Theoretiker einer »rationalen Entscheidung« –, sondern mache die Trauben im Nachhinein schlecht. Die Trauben waren nicht sauer, und der Fuchs liebte Trauben noch immer. Doch Vorlieben können, so Elster, der Anpassung auch zuwiderlaufen. In einer anderen Situation hätte der Fuchs die unerreichbaren Trauben womöglich umso mehr begehrt. Wie dem auch sei, Vorlieben sind offenbar auch durch momentane Zwänge bestimmt. Was die Frage aufwirft: »Was möchte der Fuchs eigentlich wirklich?
Während die Ökonomen Entscheidungen meist für den Ausdruck von Vorlieben halten, hegen Psychologen eher den Verdacht, dass Vorlieben erst durch die Entscheidung entstehen.8 Angenommen, der Fuchs hat die freie Wahl zwischen Trauben und Kirschen, und sagt nach dem Essen, die getroffene Wahl habe ihm besser geschmeckt.9 Hat er dann gewählt, was ihm schmeckt, oder schmeckt ihm, was er gewählt hat? Beide Annahmen könnten zutreffen, denn mit dem Geschmack ist es so eine Sache. Vielleicht fragen Sie sich an dieser Stelle schon, ob es hier wohl nur um das sensorische Geschmackserlebnis geht? Oder um unseren Kleidungsgeschmack? Oder um das, was in der Gesellschaft als »guter Geschmack« gilt? Das alles hängt auf gewisse Weise zusammen. Mag sein, dass dem Fuchs die Trauben wirklich schmecken, vielleicht gefällt ihm aber auch nur die Vorstellung, der einzige Fuchs zu sein, der Trauben liebt.
Denken Sie beim Geschmack einfach an alles, was einem gefällt – aus welchen Gründen auch immer. Dann bleibt immer noch die Frage offen, wie man weiß, was einem gefällt, oder erkennt, welchen Leuten was gefällt und warum. Oder, warum anderen, die uns ansonsten ähnlich sind, etwas nicht gefällt, was wir mögen, oder warum sich der Geschmack verändert, wofür er überhaupt gut ist und so weiter. Der Designkritiker Stephen Bayley hat irgendwann das Handtuch geworfen und gemeint: »Eine Historie des Geschmacks zu schreiben, ist mehr als schwierig, es ist unmöglich.«10 Ich glaube trotzdem, dass man Geschmack begründen kann. Wir können etwa erklären, warum wir einen bestimmten Geschmack haben und was in uns vorgeht, wenn wir uns aus dem Füllhorn der Möglichkeiten etwas herauspicken und zu unserer Vorliebe erklären.
Was ist Ihre Lieblingszahl? Wenn Sie wie die meisten ticken, dann ist es die »Sieben«. In den westlichen Industrienationen ist Sieben das Blau der Zahlen. In mehreren Studien der 1970er Jahre wurden beide so oft gemeinsam genannt, dass die Psychologie sogar vom »Blue-Seven«-Phänomen sprach, als hätte das eine mit dem anderen zu tun.11 Doch lassen wir die Farben für einen Moment außer Acht und fragen wir uns, warum die Sieben?
Wie bei den meisten Vorlieben ist die Antwort darauf eine Gemengelage aus kulturellem Lernen, psychologischer Verzerrung, inhärenten Eigenschaften und Einflüssen des Entscheidungsumfelds. Die simpelste Begründung ist die einfache Tatsache, dass die Sieben in unserem Kulturkreis so beliebt ist. Sie gilt als Glückszahl, vermutlich weil sie die »heilige Zahl par excellence« ist, so ein Forscher, und in der Bibel und der rabbinischen Literatur immer wieder auftaucht.12 Eine Rolle könnte auch spielen, dass unser Arbeitsspeicher für Ziffernfolgen bei der »magischen« Sieben ins Stocken gerät (und amerikanische Telefonnummern darum stets siebenstellig sind).13
Oder liegt es etwa an der Sieben selber? Fragt man Leute, welche Zahl zwischen eins und zehn ihnen zuerst in den Kopf kommt, nennen die meisten die Sieben – und an zweiter Stelle die...
© 2009-2024 ciando GmbH
 Zu Hanser-Fachbuch.de
Zu Hanser-Fachbuch.de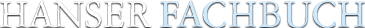
 Warenkorb
Warenkorb