Martin Windrow
Die Eule, die gern aus dem Wasserhahn trank
Mein Leben mit Mumble
1
Mann begegnet Eule – Mann verliert Eule – Mann begegnet der Eule seines Lebens
ALLES BEGANN, wie so viele Dinge in den letzten fünfzig Jahren, mit meinem älteren Bruder Dick.
Mitte der 1970er Jahre hatte er sich seinen langgehegten Traum erfüllt, aufs Land nach Kent zu ziehen und ein möglichst altes Anwesen zu erwerben, das ihm genügend Platz bot, am Wochenende seinen diversen Hobbys nachzugehen. (Dazu zählten im Lauf der Zeit: Rallyefahren, die Reparatur von Militärfahrzeugen, Luftbildarchäologie, Schrotschießen und Falkenjagd, nicht zu vergessen Bluesgitarre und allerlei andere Freizeitbeschäftigungen, die diesem Mann mit seinen Riesenpranken präzise Fingerfertigkeit abverlangten.) Da seine Ehefrau Avril nicht nur Geduld besitzt, sondern auch ausgezeichnete praktische Fähigkeiten (vom Anfertigen feiner Handarbeiten und silbernen Schmucks über Gartenarbeit und Tierhaltung bis hin zum Betonmischen, Renovieren und Dekorieren), verwandelte sich die Water Farm schon bald in einen sehr attraktiven Aufenthaltsort, obwohl die vorherigen Bewohner Schafe gewesen waren. Zudem konnte man Dick gegenüber kaum einen Gebrauchsartikel oder eine Dienstleistung erwähnen, ohne dass sein freundliches, etwas zerbeultes Gesicht diesen nachdenklichen Ausdruck angenommen hätte: »Ah, interessant – ich kenne da zufällig jemanden, der … (… einen Panzermotor verkauft, Schaffelle trocknet, als Stuntman beim Film arbeitet, genau weiß, zu welchen Zeiten die Kaninchengehege seiner Lordschaft am Wochenende unbewacht sind, sich mit Sprengstoff auskennt, Wildschweine züchtet, Holländisch spricht, Objekte in Kunstharz gießt, einem ohne lästigen Papierkram x-beliebige Dinge besorgen kann, etc. etc.).
Damals wohnte ich in einem Hochhaus in Croydon, South London, und pendelte täglich zwischen meinem Wohnort und Covent Garden hin und her, wo ich in einem Verlag als Lektor mit militärhistorischen Werken befasst war. Unsere Großfamilie verbrachte Weihnachten meist auf der Water Farm, und da sich sowohl mein Privatleben als auch mein Berufsalltag zwischen schmutzigem Beton und Dieselabgasen abspielte, nahm ich Dicks und Avrils grenzenlose Gastfreundschaft oft auch im Sommer in Anspruch und verbrachte die Wochenenden in Kent. Die beiden unterhielten eine ganze Menagerie, im Lauf der Jahre immer wieder andere Tiere: zahllose Katzen (einschließlich einer, die mir bei der Kaninchenjagd beschämend deutlich den Rang ablief), Tauben, Hühner, Enten, Gänse, Truthähne, ein paar Schafe, eine Ziege, einen Esel, eine Dexter-Aberdeen-Angus-Kuh, Shreds, die wunderbare Waldiltis-Frettchen-Kreuzung meines Neffen Stephen, und eine Zeitlang sogar einen Waschbären (voll ausgewachsen sind Waschbären wesentlich größer und kräftiger, als man gemeinhin glaubt). Ich „hatte“ es eigentlich gar nicht so mit Tieren, aber sicherlich trug dieser kleine Zoo zur Attraktivität der Water Farm bei, neben all den anderen Verlockungen – Friede, Weiträumigkeit, reine Luft und Avrils überragende Kochkünste.
Noch vor dem Umzug auf die Water Farm hatte Dick sich für Bücher über die Falkenjagd interessiert. Selbstverständlich fand er auch in diesem Bereich bald Freunde und erwarb seinen ersten Vogel – einen wunderbar glänzenden Falken namens Temudjin, nach dem jungen Dschingis Khan. Nachdem Dick die Farm gekauft hatte, baute er Käfige und Volieren, die den Vögeln genügend Bewegungsspielraum boten, und da sich sein Wissen, sein Können und sein Bekanntenkreis immer mehr vergrößerten, waren diese Unterkünfte ständig belegt. Zu den Insassen zählten Turmfalken, Bussarde, Habichte und sogar ein etwas lädierter Steppenadler, der an „Pododermatitis“ litt (nein, sagt mir auch nichts).
Ich beobachtete, wie Dick mit den Raubvögeln umging und sie ausbildete, und wurde von seiner Faszination unweigerlich angesteckt. Als ich eines Tages auch einmal einen Falken auf die behandschuhte Faust nehmen durfte, um gemeinsam mit Dick durch die Felder zu streifen, wehte mich sofort der Zauber des Mittelalters an. Ein unbeschreibliches Gefühl. Natürlich war auch Eitelkeit im Spiel: Der Mann muss erst noch geboren werden, der nicht die Pose eines Plantagenet einnimmt und lässig das Brustgefieder seines Falken streichelt, wenn hinter einer Wegbiegung eine Schar gebührend beeindruckter Spaziergänger erscheint … Aber es schmeichelte nicht nur dem Ego; für mich war das eine bisher ungekannte Art von Beziehung, die mich mit ganz neuen Empfindungen erfüllte. Sie schienen sehr tief zu sitzen und weit zurückzureichen. Es war ein langsamer Prozess, den ich mir eine ganze Weile gar nicht eingestand, doch allmählich spürte ich ganz bewusst, dass ich mit diesem Neuen auf Dauer in Verbindung bleiben wollte.
Der Gedanke, in einem Hochhausapartment in South London einen Falken zu halten, war natürlich abwegig, dennoch verfolgte mich dieser Traum. Schließlich wies mir meine Schwägerin unwissentlich den Weg. Avril hatte sich schon seit einiger Zeit einen eigenen Vogel gewünscht, aber einen, der sich problemlos in ihren Alltag als unermüdlich tätige Mutter zweier Söhne fügte. Gewissenhaft hängte Dick sich ans Telefon und rief ein paar Herren mit lustigen Spitznamen an, und eines Tages ließ sich „Wol“ in Avrils Küche nieder, wo er die meiste Zeit auf einem schattigen Ausguck hoch oben auf dem großen Küchenbuffet hockte. Avrils Küche war für zufällige Besucher ohnehin ein willkommener Hafen und gewann durch die Gegenwart des Käuzchens noch größere Anziehungskraft. (Wol saß so still, dass die meisten Leute dachten, er sei ausgestopft, bis ein gelegentliches Blinzeln die Wahrheit verriet; gelegentlich kam es dann vor, dass ein Besucher Kaffee verschüttete oder sich an einem Bissen Kuchen verschluckte.)
Wol bezauberte mich vom ersten Moment an, und als ich miterlebte, wie problemlos und unaufgeregt sich eine Eule – wenn man sie jung genug bei sich aufnimmt – an menschliche Gesellschaft gewöhnen kann, setzte ich dem nagenden Wunsch, selbst einen Vogel zu besitzen, immer weniger Widerstand entgegen.
* * *
Im Sommer 1976 baten ein Freund und ich um gastliche Aufnahme in der Water Farm, während wir auf einem nahegelegenen Flugplatz einen kurzen Fallschirmspringkurs absolvierten.
Damals verfügten Anfänger noch nicht über die moderne Fallschirmausrüstung mit ihren relativ leichten Packs, matratzenförmigen Fallschirmkappen und präziser Steuerung, die einem fast immer eine aufrechte Landeposition erlaubt. Roger und ich bekamen gezeigt, wie man Landerollen macht; ohne die ging es nicht bei den alten Irvin-Fallschirmen, deren X-Type-Gurtwerk zentnerschwer an uns hing (und uns mit der Grazie eines Kartoffelsacks zu Boden brachte).
Mein erster Sprung war ebenso schrecklich wie beglückend. Zuerst kam der bodenlose, blanke Horror, als der Motor der kleinen Cessna abgeschaltet wurde und ich hinauskletterte und zwischen Tragflächenstrebe und Fahrwerk balancierte, wobei ich Mühe hatte, im brausenden Wind den Absetzer zu verstehen, der noch einmal alle wichtigen Punkte durchging. Dann – als sich der Schirm ruckartig geöffnet hatte, das enganliegende Gurtwerk mich hielt wie Gottes Hand und von unten die Landschaft Kents zu mir emporlächelte – überflutete mich ein absolutes Hochgefühl, das sich noch verstärkte, als ich mich nach erfolgreicher Landung wieder vom Boden aufrappelte.
Zur denkwürdigsten Erfahrung jedoch geriet der dritte Sprung. Aufgrund meiner äußerst mangelhaften motorischen Fähigkeiten, die schon in meiner Schulzeit den Sportlehrern auffielen, verschätzte ich mich, während der Boden in den letzten Sekunden auf mich zuraste, bei der Landerolle total. Mit dem Hintern voran schlug ich auf und zog mir eine der klassischen (und wahnsinnig schmerzhaften) Fallschirmsportverletzungen zu – eine Kompressionsfraktur der Lendenwirbel. Der arme Roger, der den langen Strohhalm gezogen hatte und sich immer noch Hunderte Fuß über dem Sprungplatz befand, musste sich auf seine eigene Landung vorbereiten, während er mitbekam, wie ich mich laut stöhnend am Boden krümmte. Meine eindrücklichste Erinnerung der nächsten halben Stunde ist die an einen jungen Offiziersanwärter, der im Kreis der anderen um mich herumstand. Während sonst alle besorgt auf mich herunterstarrten, steckte er sich eine Zigarette in den Mund, klopfte zerstreut auf seine Taschen, murmelte seinen Kameraden etwas zu – die den Kopf schüttelten, ohne ihre ernsten Blicke von mir zu wenden –, beugte sich dann zu mir herunter und bat mich um Feuer. Da ich in Gedanken gerade mit meinem Rückgrat beschäftigt war, konnte ich ihm leider nicht damit dienen.
Im Juni 1976 stöhnte Südengland unter einer Hitzewelle, wie es sie nur alle zwanzig Jahre einmal gibt, und ich lag schweißüberströmt und völlig bewegungsunfähig in einem Klinikbett; dieses Bett stand unmittelbar unter einem großen Oberlicht, das in die niedrige Decke eines einstöckigen Seitentrakts eingelassen war. In der sengenden Sonne angepflockt wie ein Apachen-Opfer, voller Ekel vor dem ungenießbaren Klinikfraß, habe ich es zwei Personen zu verdanken, dass ich durchgehalten habe – erstens einer netten erfahrenen Nachtschwester, die ein entspanntes Verhältnis zu Pethidin-Injektionen bewies, und zweitens Dick, der mich jeden Abend auf dem Heimweg von der Arbeit getreulich besuchte und mir köstliche Sandwiches mitbrachte. Nach einer Woche in verschwitzten Laken, eingezwängt in Metallschienen, schaffte ich es schließlich, schwerfällig zu Dicks Wagen hinauszuwanken, wie Boris Karloff in Frankenstein, und wurde zur Water Farm...
© 2009-2024 ciando GmbH
 Zu Hanser-Fachbuch.de
Zu Hanser-Fachbuch.de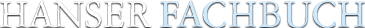
 Warenkorb
Warenkorb
