Daniel Tammet
Die Poesie der Primzahlen
2
Die Ewigkeit in einer Stunde
Es war einmal ein Kind, das gerne Märchen las. Dieses Kind war ich. Zu meinen Lieblingsmärchen gehörte Der süße Brei von den Gebrüdern Grimm: Ein armes, aber liebes Mädchen bekommt von einer Zauberin einen Kochtopf geschenkt, der auf den Befehl »Töpfchen, koch« so viel süßen Hirsebrei kocht, wie das Mädchen und seine Mutter essen möchten. Eines Tages, als das Töchterchen nicht zu Hause ist, vergisst die Mutter die magischen Worte »Töpfchen, steh«, damit der Topf zu kochen aufhört.
»Und so kochte das Töpfchen immer weiter, und der süße Brei quoll über den Rand, und noch immer kochte es weiter, bis der süße Brei die Küche und das ganze Haus überquoll, und dann das nächste Haus, und dann die ganze Straße, als wolle es den Hunger der ganzen Welt stillen.« Erst als die Tochter wieder nach Hause kommt und den Spruch aufsagt, kann die klebrige Brei-Lawine endlich angehalten werden.
Mit diesem Märchen führten mir die Gebrüder Grimm erstmals das Geheimnis der Unendlichkeit vor Augen. Wie konnte so viel süßer Brei aus einem so kleinen Topf quellen? Ich kam ins Grübeln. Ein einziges Hirsekorn ist sehr klein. In einer Schüssel kann man es mit dem Löffel kaum finden. Dasselbe gilt für einen Tropfen Milch und ein Körnchen Zucker.
Wenn nun aber ein magischer Kochtopf diese kleinen Hirsekörner, Milchtropfen und Zuckerkörnchen auf seine eigene besondere Weise verteilte? Und zwar so, dass jedes Körnchen, jeder Tropfen und jedes Zuckerkörnchen eine eigene Position im Topf bekam und sie einander nicht berührten? Ich stellte mir 5, 10, 50, 100 und 1000 isolierte Körner, Tropfen und Körnchen vor, die im gekrümmten Raum schwebten wie Sterne. Immer mehr Hirsekörner, mehr Milchtropfen und Zuckerkörnchen würden hinzugefügt, so dass sie schließlich Konstellationen, winzige Große Wagen und Große Bären bilden. Nehmen wir nun an, wir erreichten das 10 473. Hirsekorn. Wo stecken wir es hin? Hier stellte mein kindlicher Geist sich all die winzigen Lücken – Tausende Lücken – zwischen den Hirsekörnern, Milchtropfen und Zuckerkörnern vor. Für jedes neue Korn würden auch neue winzige Lücken entstehen. Solange der Topf auf seine magische Art jede Berührung zwischen den Körnern verhinderte, würde jedes neue Hirsekorn (und jeder Milchtropfen und jedes Zuckerkörnchen) seinen Platz finden.
Hans-Christian Andersens Märchen Die Prinzessin auf der Erbse ließ mich in meiner Vorstellung ebenfalls zu einer Reise ins Unendliche aufbrechen, diesmal aber in die Unendlichkeit der Bruchteile. Eines Nachts klopft eine junge Frau, die sich als Prinzessin ausgibt, an die Tür eines Schlosses. Draußen stürmt es, und die Regenschauer durchweichen ihr Kleid und färben ihr goldenes Haar schwarz. Sie sieht so elend aus, dass die Königin nicht glaubt, dass das Mädchen adeliger Herkunft ist. Um die junge Frau zu prüfen, lässt die Königin eine Erbse unter die Liegestatt legen, auf der sie die Nacht verbringen soll: 20 aufeinandergestapelte Matratzen; am nächsten Morgen beklagt die junge Frau sich, dass sie kein Auge zugetan habe. Der Gedanke an diesen aufgetürmten Matratzenstapel ließ auch mich wochenlang kein Auge zutun. Nach meiner Berechnung würde eine zweite Matratze die Entfernung zwischen dem Rücken der Prinzessin und der störenden Erbse verdoppeln. Das harte kleine Gemüse wäre damit nur noch halb so gut spürbar wie unter einer Matratze. Eine weitere Matratze würde die Spürbarkeit auf ein Drittel reduzieren. Mir leuchtete ein: Wenn die Prinzessin so empfindlich ist, dass sie eine halbe Erbse (unter zwei Matratzen) oder eine Drittelerbse (unter drei Matratzen) spüren kann, warum sollte sie dann nicht auch feinnervig genug sein, um eine Zwanzigstel-Erbse zu spüren? Meine Vorstellung ging aber noch weiter. Grenzenlose Sensibilität vorausgesetzt (wir befinden uns schließlich im Märchen), würde für die Prinzessin auch eine Hundertstel-, Tausendstel- oder Millionstel-Erbse unerträglich.
Das führte mich zurück zu den Brüdern Grimm und dem Märchen vom süßen Brei. Für die Prinzessin fühlte sich schon eine einzige Erbse unendlich groß an; eine riesige Lawine von Brei konnte nur durch unendlich kleine Zwischenräume zwischen den Körnern entstehen.
»Du hast zu viel Fantasie«, sagte mein Vater, als ich ihm davon erzählte. »Dauernd steckst du die Nase in Bücher.« Mein Vater besaß bloß einen Stapel Taschenbücher und kaufte sich regelmäßig die Wochenendausgaben der Times, aber er war kein besonders begeisterter Leser. »Spiel lieber draußen – es tut dir nicht gut, den ganzen Tag im Haus eingepfercht zu sein.«
Das Versteckspiel im Park mit meinen Geschwistern dauerte zehn Minuten. Die Schaukel interessierte mich etwa genauso lange. Wir spazierten einmal um den See und warfen Brotkrumen hinaus auf das schmutzige Wasser. Sogar die Enten wirkten gelangweilt.
Im Garten zu spielen war unterhaltsamer. Wir spielten Krieg, Zaubern und Zeitreise. In einem Pappkarton segelten wir den Nil hinab und erklärten ein Bettlaken zu einem Zelt in den sieben Hügeln Roms. Dann wieder lief ich einfach nach Herzenslust durch unser Viertel und dachte mir alle möglichen Abenteuer und Expeditionen aus.
Als ich eines Tages gerade aus China zurückkam, hörte ich das Grummeln eines nahenden Gewitters und suchte Deckung in der Gemeindebibliothek. Dort kannten mich alle, ich war Stammgast. Beim Hereingehen tauschte ich immer ein angedeutetes Nicken mit den Bibliothekaren aus. Ganze Korridore voller Bücher erstreckten sich um sie herum, in Jahrhunderten angehäuftes Wissen bedeckte die Wände, und ich fuhr im Gehen mit den Fingerspitzen die scheinbar endlosen Bücherreihen entlang.
Meine Lieblingsabteilung war angefüllt mit Wörterbüchern und Lexika, den Mauersteinen unter den Büchern. Sie versprachen die Summe allen menschlichen Wissens (was sie allerdings nicht halten konnten): alle Tatsachen, alle Begriffe, alle Wörter. Diese ungeheure Informationsvielfalt war durch Gliederung in Abteilungen gebändigt – A bis C, D bis F, G bis I –, und jede Abteilung enthielt Unterabteilungen – Aa bis Ad ... Di bis Do ... Il bis In. Viele von diesen hatten wieder eigene Unterabteilungen – Hai bis Han ... Una bis Unf –, und selbst von diesen teilten sich manche noch weiter – Inte bis Intr zum Beispiel. Wo sollte man da anfangen? Und, was vielleicht noch wichtiger war, wo sollte man aufhören? Ich überließ die Entscheidung gewöhnlich dem Zufall. Ich zog irgendeinen Lexikonband aus dem Regal, öffnete ihn auf gut Glück und saß dann eine Stunde lang da und las über Bora Bora, über die Borborygmi und die Borg-Skala für subjektives Belastungsempfinden.
Gedankenverloren bemerkte ich zunächst nicht das hartnäckige Tapp tapp der sich nähernden Schritte auf dem gebohnerten Boden. Sie gehörten zu einem der leitenden Bibliothekare, der zugleich unser Nachbar war; seine Frau war mit meiner Mutter befreundet. Er war hochgewachsen (wobei für ein Kind natürlich alle Erwachsenen groß sind) und dünn, und auf seinem langen Kopf saßen ganz oben ein paar Büschel ergrauender Haare.
»Ich habe ein Buch für dich«, sagte der Bibliothekar. Ich spähte einen Moment lang nach oben, bevor ich ihm seine Empfehlung aus den großen Händen nahm. Der Umschlag trug einen Aufkleber, der besagte, dass es sich um die Monatsauswahl des Bookworm Club, des Vereins der Bücherwürmer, handele. Das Buch hieß Die Borger. Ich bedankte mich brav, weniger aus echter Dankbarkeit als aus dem Wunsch heraus, der Bibliothekar möge aus dem Licht gehen und die plötzliche Verdunkelung meines Lesetisches beenden. Doch als ich diesen eine Stunde später verließ, nahm ich das Buch mit, ordnungsgemäß entliehen und fest unter den Arm geklemmt.
Es erzählte die Geschichte einer winzigen Familie, die unter den Fußbodendielen eines Hauses lebte. Um ihr kleines Heim zu vollenden, wagte der Vater sich von Zeit zu Zeit hinaus und ›borgte‹ sich dies und das aus dem Haushalt.
Meine Geschwister und ich versuchten uns vorzustellen, wie es wohl wäre, so klein zu sein. Vor meinem geistigen Auge wuchs die Welt immer weiter. Je kleiner ich wurde, desto größer wurde meine Umgebung. Das Vertraute sah plötzlich seltsam aus; das Seltsame wurde vertraut. Ein Gesicht mit Ohren und Augen und Haaren wurde auf einmal zu einem rosa gefärbten Feld voller Büsche, Furchen und Gänge. Selbst der kleinste Fisch wird zum Wal. Staubflocken fliegen davon wie Vögel, sie segeln und kreisen über meinem Kopf. Ich schrumpfte, bis alles Vertraute restlos verschwunden war und ich einen Berg Bügelwäsche nicht mehr von einem Felsen unterscheiden konnte.
Bei meinem nächsten Bibliotheksbesuch trat ich prompt dem Verein der Bücherwürmer bei. In jedem Monat wurde ein klassisches Kinderbuch empfohlen, einige von ihnen fand ich durchaus spannender als andere, aber am allerbesten war die Dezembergeschichte, die mich wirklich packte: Die Königin von Narnia aus C. S. Lewis’ Chroniken von Narnia. Als ich das Buch aufschlug, folgte ich Lucy, die mit ihren Geschwistern »aus London weggeschickt wurde, weil Krieg war und es Luftangriffe gab … und zwar zu einem alten Professor, dessen Haus im Herzen des Landes lag.« Es war »die Art Haus, in dem man nie ans Ende zu kommen scheint, und es war voller unerwarteter Orte«.
Mit Lucy trat ich in den großen Kleiderschrank eines ansonsten leeren Raumes, auch meine Frisur zerzaust von den...
© 2009-2024 ciando GmbH
 Zu Hanser-Fachbuch.de
Zu Hanser-Fachbuch.de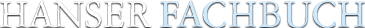
 Warenkorb
Warenkorb
